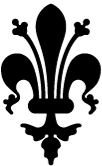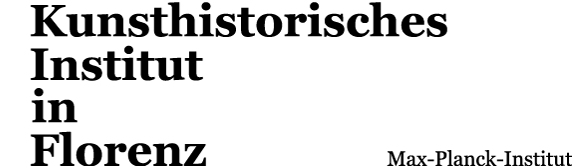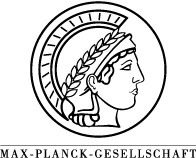Robert Felfe: Studiolo und Kunstkammer: Reichweite und Grenzen einer genealogischen Beziehung
Wissenschaftliches Kolloquium im Rahmen des Studienkurses 2007
Mit guten Gründen gelten die Studioli italienischer Fürsten als ein Vorläufer jener Kunstkammern, die seit dem 16. Jahrhundert auch unter Bezeichnungen wie cabinet de couriosité, Rariteitenkammer oder Musaeum europaweit Verbreitung fanden. Räumliche Ausstattung und Sammlungsbestände der einzelnen Kunstkammern variierten dabei erheblich. Je nach sozialem Stand, Vermögen und Interessen des jeweiligen Sammlers konnten zum Beispiel sehr verschiedene Objektgruppen im Vordergrund stehen - von den Werken zeitgenössischer Künstler über wissenschaftliche Instrumente bis zu Exponaten aus den drei Reichen der Natur. Über alle Unterschiede der jeweiligen Sammlungen hinweg galt dabei ein enzyklopädischer Anspruch als konzeptueller Rahmen, der die Kunstkammer als historisch spezifischen Typus von Sammlungen kennzeichnet, in dem naturalia und artificialia in einer engen systematischen Beziehung standen.
Ausgehend von den skizzierten Aspekten wird der Vortrag Studiolo und Kunstkammer in ihrer geschichtlichen Beziehung auf markante Kontinuitäten hin untersuchen; kontrastiv dazu aber auch auffällige Differenzen und Brüche aufzeigen. So wurde das Studiolo in der Forschung mehrfach - wenngleich nicht ausschließlich so doch in erster Linie - als privater Ort des Studiums, der Zurückgezogenheit und individuellen Meditation beschrieben. An Ausstattung und räumlicher Disposition lassen sich Bildungskonzepte festmachen, in denen das Ideal der vita contemplativa Formen einer neuen Subjektivität mitgeprägt hat. In der Kunstkammer scheint tendenziell das Gegenteil der Fall zu sein. Dies wird vor allem dort deutlich, wo die Sammlungen in hohem Maße Orte kollektiver Erfahrung und Kommunikation waren, wo Experimente stattfanden und wo künstlerisches Handwerk nicht nur ausgestellt, sondern auch praktiziert wurde. Besonders im Umfeld von Gelehrtengesellschaften und Akademien waren Kunstkammern dabei nicht selten Orte avancierter Forschung im Sinne der entstehenden modernen Wissenschaften.
In diesem Spannungsfeld wird der Vortrag sich auf die Frage konzentrieren, inwiefern in beiden Raumtypen Ausstattung und Umgang mit Bildern nicht nur programmatisch Konzepte von Bildung und Wissen darstellen, sondern selbst zu Instrumenten von Erkenntnis werden konnten.
Robert Felfe studierte von 1991 bis 1997 Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2000 Promotion im Fach Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2002 Wiss. Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen an der Freien Universität Berlin, Projektleiter: Prof. Hartmut Böhme. Projekttitel: Die Kunstkammer und ihre Aktualität. Museale Inszenierungen von Naturgeschichte in Früher Neuzeit und Gegenwart. Seit 2002 regelmäßige Lehrtätigkeit am Kulturwissenschaftlichen sowie am Kunsthistorischen Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Sammlungsgeschichte Frühe Neuzeit; Naturwissenschaften und Bildpraxis; Bildtheorie und Grafik 16.-18. Jahrhundert; zeitgenössische Kunst.
Konferenzsaal
Via Giuseppe Giusti 38
50121 Florenz
Avviso
Questo evento viene documentato fotograficamente e/o attraverso riprese video. Qualora non dovesse essere d’accordo con l’utilizzo di immagini in cui potrebbe essere riconoscibile, da parte del Kunsthistorisches Institut in Florenz a scopo di documentazione degli eventi e di pubbliche relazioni (p.e. social media) la preghiamo gentilmente di comunicarcelo.