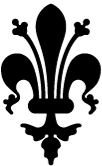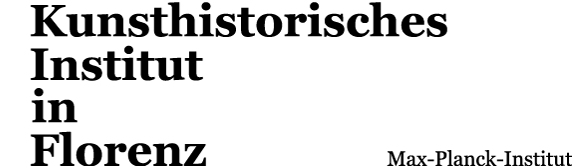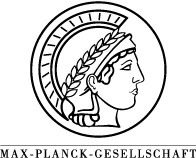Workshop
Bildersammlungen als Denkmaterial. Materialismen, Realismen, Kunst (1900-1960)
organisiert von Carolin Behrmann (Minerva Forschungsgruppe "Nomos der Bilder. Manifestation und Ikonologie des Rechts") und Steffen Haug (Arbeitsstelle Aby "Warburg-Edition" am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin)
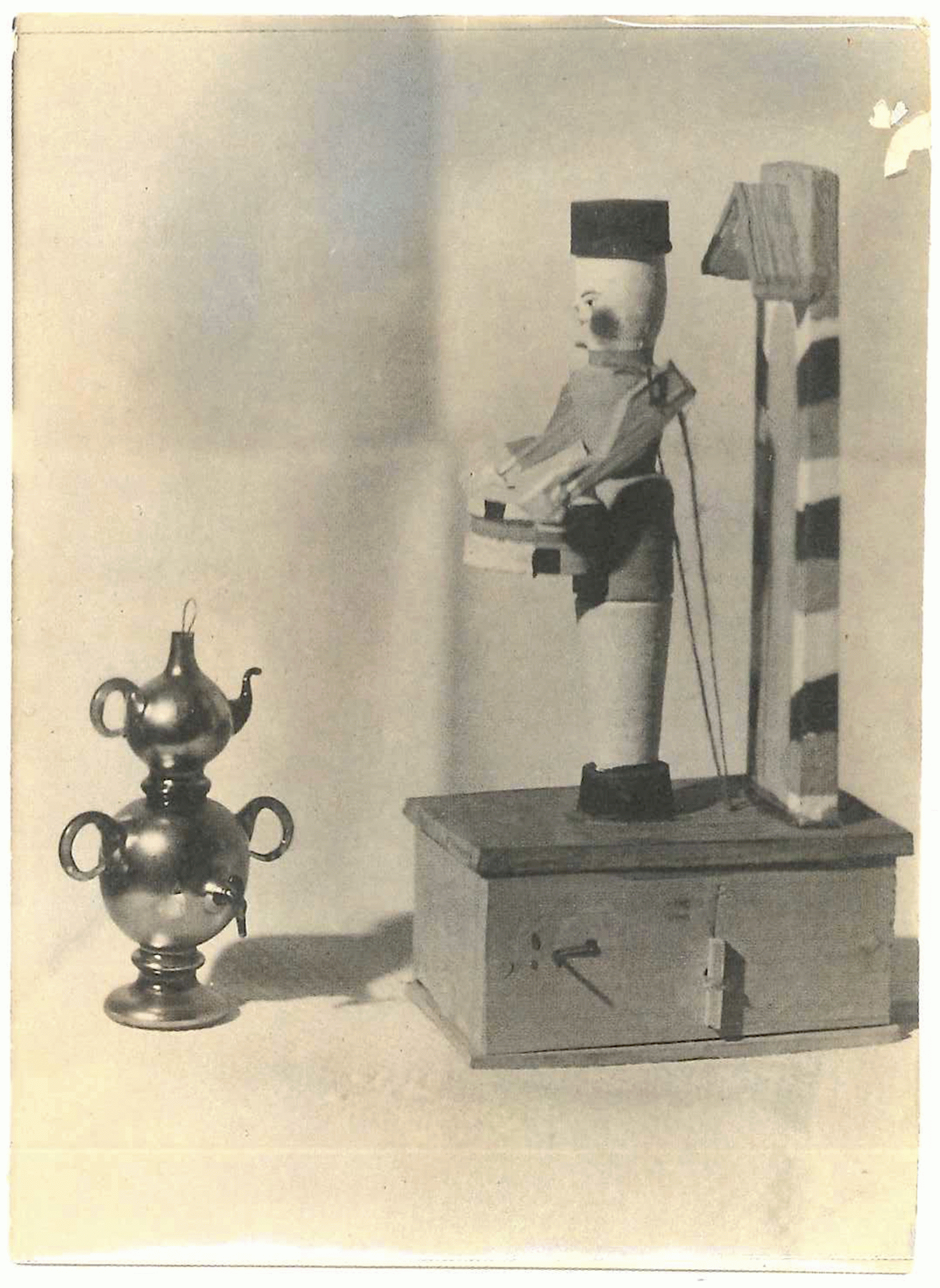
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildete sich eine materialistische Kunsttheorie heraus. Sie wurde von Karl Marx historischer Kritik geprägt, griff aber ebenso auf die zeitgenössischen Methoden der Kunstgeschichte und der entstehenden Kulturwissenschaften zurück, um diese zu erweitern. Nach frühen Ansätzen bei Eduard Fuchs widmeten sich vor allem Max Raphael, Walter Benjamin und Frederick Antal den ökonomischen und sozialen Entstehungsbedingungen der Kunst, um auf dieser Grundlage einen materialistischen Kunstbegriff zu entwickeln. Mit der Kritik am etablierten Kanon erweiterte sich auch der kunsthistorische Phänomenbereich: Neben den namenlosen und alltäglichen Objekten der Massenproduktionen rückten Volkskunst, Fotografie und Film sowie marginalisierte Genres wie Karikatur, Groteske oder Erotik in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Da solche Objekte kaum in institutionellen oder musealen Beständen vorhanden waren, wurde versucht, über eigene Sammlungen und Systematisierungsversuche in das grenzenlos erscheinende Untersuchungsmaterial eine Ordnung zu bringen. Auch gab es Versuche, die bestehende museale Erzählung im Hinblick auf die neue "materialistische Kunsttheorie" zu erweitern. Den Gegenständen und den ihnen abgewonnenen Theorien und Denkweisen, die sich dezidiert von positivistischen Verfahren der Tatsachenanhäufung distanzierten, um ästhetische Kategorien kritisch zu hinterfragen, will sich der Workshop in zwei Teilen zuwenden. Mit welchen Genres, Bildern und Formen hat sich die materialistische Kunstwissenschaft befasst? Welche Erkenntnisinteressen haben sie geleitet? In anderen Worten: Wie bildete sich ihre Theorie in und an der Wahrnehmung ihrer Objekte heraus? Welche Prägung erhält das Denken, wenn es aus einer privat angelegten Sammlung hervorgeht? Was sind wiederum die Charakteristika einer Kunstgeschichte, die sich auf museale Sammlungen und Displays bezieht?
Um eine wissenschaftshistorische Einordnung der materialistischen Ansätze in der Methodengeschichte der Kunstwissenschaft zu ermöglichen, sollen andere Disziplinen mit herangezogen werden, die sich seit dem 19. Jahrhundert ebenfalls den Sammlungen massenhaft produzierter Bilder bedienten, an denen sie einen spezifischen Geschichtsbegriff ausbildeten (Anthropologie, Ethnologie, Philosophie, Psychologie, Recht). Mit den neuen technischen Reproduktionsmedien/verfahren stand den Wissenschaftlern eine bis dahin ungekannte Fülle an Bildern zur Verfügung, die neben die Originale in Museen und Sammlungen traten. Hierzu gehören nicht nur Fotografien und Abgüsse, sondern auch illustrierte Zeitungen, umfangreiche Mappenwerke, Bücher zur Geschichte von Kunst und Populärgrafik sowie der Film. Sammlungen werden dabei auf vielfältige Weise gedanklich nutzbar gemacht: Während viele Forscher selbst sammelnd tätig wurden, haben andere durch Beschreibungen und Notizen auf Bilder verwiesen oder imaginäre Konstellationen erdacht, an deren Betrachtung entlang sie ihre Theorien entwickelten. Welche Bedeutung spielt die eigene zeichnerische oder malerische Praxis für die Bildung von Theorien, oder auch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst?
Der Workshop will verschiedene Material- und Bildersammlungen des 20. Jahrhunderts in den Blick nehmen und herausarbeiten, wie diese auf Grundlage theoretischer Annahmen zusammengetragen wurden und auf diese zurückgewirkt haben. Der Wahl der Gegenstände und ihrer Anordnung als Arbeitsgrundlage soll ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden wie den Theorien, die aus ihnen gezogen wurden. Hierbei werden auch biographische, historische und politische Umstände in Rechnung zu stellen sein, in denen Sammlungen aufgebaut oder auch verhindert wurden. Jene Techniken, die aufgrund von Verfolgung und Exil, aber auch politischer Marginalisierung als Alternativen entstanden, sollen den etablierten Instrumenten der Wissensgenerierung gegenübergestellt werden. Der Workshop versteht sich als kritische Annäherung an ein historisches Feld, dessen Konstellationen und Fragestellungen auch in den heutigen Debatten um den "neuen" Realismus, Materialität und Objektbegriff relevant geblieben sind.
Downloads
Kooperationspartner
in Kooperation mit
07. – 08. Dezember 2016
Kunsthistorisches Institut in Florenz
Max-Planck-Institut
Palazzo Grifoni Budini Gattai
Via dei Servi 51
50122 Firenze
Hinweis
Diese Veranstaltung wird durch Fotografien und/oder Videoaufnahmen dokumentiert. Falls es nicht Ihre Zustimmung findet, dass das Kunsthistorische Institut in Florenz Aufnahmen, auf denen Sie erkennbar abgebildet sein könnten, für die Veranstaltungsdokumentation und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Social Media) verwendet, bitten wir um eine entsprechende Rückmeldung.